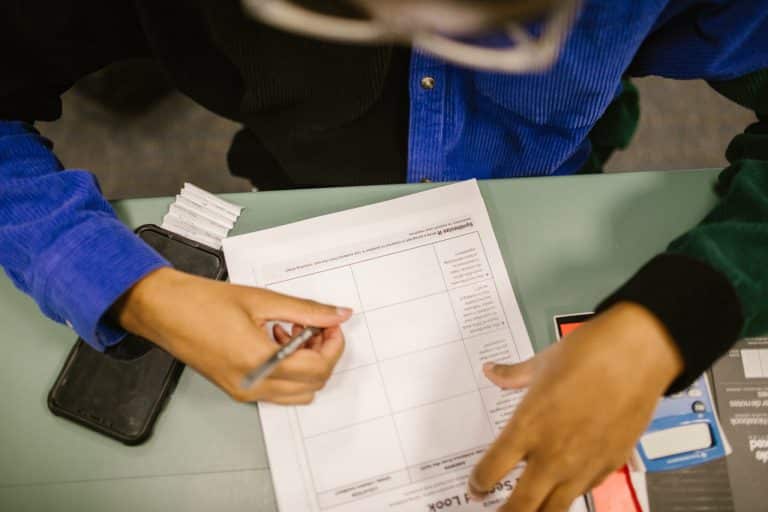Der Offene Ganztag (OGS) der Astrid-Lindgren-Schule wird von Schüler*innen diverser sprachlicher und kultureller Hintergründe besucht. Auch mit der Elternschaft wird in vielen Sprachen kommuniziert – über vielfältige Wege aber bisher nicht immer erfolgreich. Daher war das Ziel der Mitarbeiter*innen der OGS die Entwicklung einer niedrigschwelligen und barrierefreien Kommunikation mit der Elternschaft.
Wie sind Eltern in der OGS am besten kommunikativ erreichbar?
Die OGS der Astrid-Lindgren-Schule betreut Kinder der Schulklassen eins bis vier. Die Elternarbeit und insbesondere der Austausch zwischen Mitarbeiter*innen und Eltern macht einen bedeutenden Teil des Arbeitsalltags in der OGS aus. Für die Eltern ist es beispielsweise wichtig über Themen wie Termine für Ausflüge, Events und neue Angebote Informationen sowie Feedback zum Alltag der Kinder in der OGS zu erhalten. Hier waren allerdings noch viele Fragen offen: Wie erreicht man die Eltern am besten? Über welche Sprache? Über welche Wege? In welcher Häufigkeit? Die Studierenden sollten die OGS dabei unterstützen, die Kommunikationserfahrungen, ‑bedarfe und ‑wünsche der Eltern zu ermitteln. Die Elternkommunikation stellte für die OGS bisher eine große Herausforderung dar.

E‑Mails, Briefe oder Informationsblätter erreichten die Eltern der Kinder oftmals nicht. Auch die Kommunikation in deutscher Sprache war für viele Eltern nicht oder nur schwer möglich. Daher war das erklärte Ziel des Projekts, gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen zu ermitteln, wie Eltern am besten erreichbar sind und welche Kommunikationswege sich zukünftig zwischen Eltern und OGS Mitarbeiter*innen anbieten. Insgesamt sollte dadurch der Informationsaustausch in der OGS mit den Eltern verbessert werden.
Ermittlung von Kommunikationsbedarfen per Fragebogen
Ziel des Projekts war es somit, die sprachliche Vielfalt der Eltern der Schüler*innen, deren technische Ressourcen sowie Kommunikationsroutinen, ‑bedarfe und ‑wünsche zu ermitteln, um anknüpfend daran Handlungsempfehlungen für die Elternkommunikation in der OGS zu entwickeln. In regelmäßigen Sitzungen erarbeiteten die Studierenden in enger Kooperation mit der OGS den digital sowie analog verfügbaren Fragebogen und planten die Befragung.
In dem Fragebogen wurden schließlich Fragen nach der gesprochenen Sprache der Eltern, bevorzugten Kommunikationswegen im Alltag, Wege des üblichen Informationsaustausches, Problemen im Umgang mit Medien und eigenen Wünschen zur Kommunikation mit der OGS aufgenommen. Der Fragebogen beinhaltete zum Großteil ankreuzbare Multiple-Choice-Fragen. Bei einigen Fragen wurde ergänzend dazu auch Raum für eigene Kommentare gegeben. Diese Möglichkeit wurde seitens der Eltern auch genutzt, um ihre bevorzugten Kommunikationswege sowie Wünsche an die OGS mitzuteilen.
Mit Hilfe des kostenlosen Online-Tools „DeepL“ wurde der Fragebogen dann in insgesamt sieben Sprachen übersetzt, auf diese Weise sollten möglichst viele Eltern erreicht werden. Der Online-Fragebogen wurde auf der Website SoSci zur Verfügung gestellt. Den Link zum Fragebogen versandten die Mitarbeiter*innen der OGS über eine E‑Mail an die Eltern. Ergänzend dazu wurde eine Papierversion erstellt und an die Eltern verteilt.
Erste Ergebnisse und was nun zu tun ist
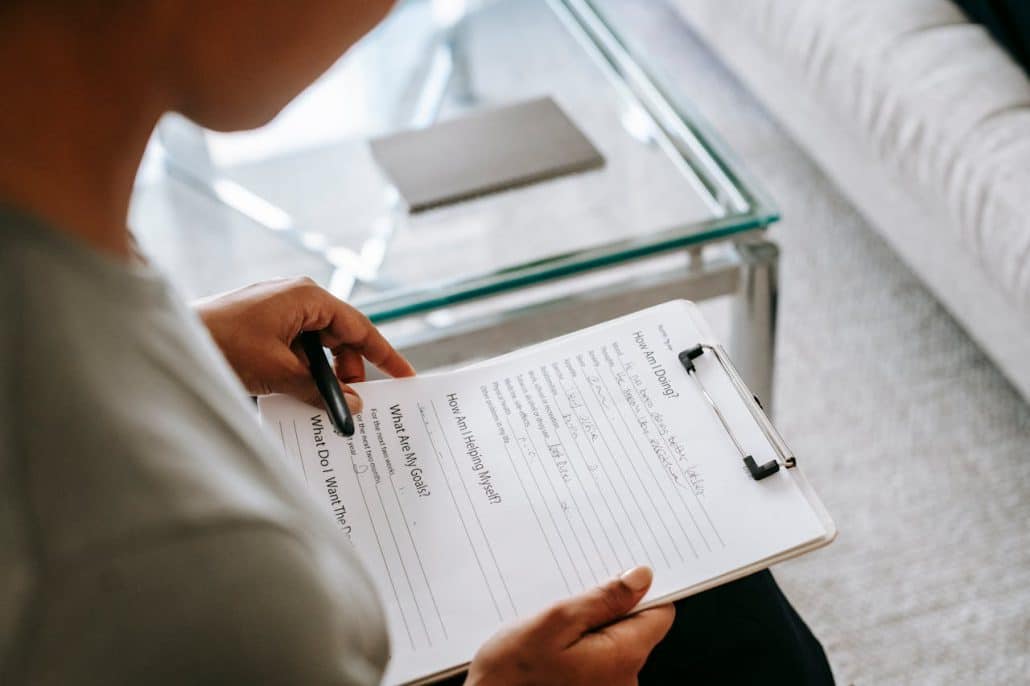
Die Auswertung des Fragebogens zeigte, dass die fortschreitende Digitalisierung bereits Spuren auch in der Elternkommunikation hinterlassen hat. Alle Eltern, die an der Befragung teilgenommen haben, haben den Fragebogen online ausgefüllt. Auch die genutzten Kommunikationswege der Eltern zeigen, dass sie privat digitale Wege bevorzugen. Am häufigsten genutzt werden bisher WhatsApp, Telefon und E‑Mail.
Dies unterstützt die Idee, zukünftig eine digitale Lösung zur Elternkommunikation für die OGS anzustreben. Ergänzend dazu zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass ein Großteil der Eltern die Qualität der bisherigen Kommunikation mit der OGS als durchaus gut bewertet. Gleichzeitig äußern die Eltern aber auch den deutlichen Wunsch nach einer sprachlich niederschwelligen und digitalen Möglichkeit zur Kommunikation. Auch zeigten die Ergebnisse, dass einige der nicht-deutschsprachigen Elternteile keine Personen in ihrem privaten Umfeld haben, die für sie die bisher versandten Informationen der OGS übersetzen konnten. Daher ist zukünftig darüber nachzudenken, ob und in welcher Weise die Elternkommunikation mehrsprachig zu gestalten ist. Gleichzeitig zeigte sich, dass ein Großteil der Eltern den Fragebogen auf Deutsch ausfüllte, obwohl sie laut eigener Angaben kein Deutsch verstehen. Möglicherweise wurde sich hier mit digitalen Übersetzungstools beholfen, was einen weiteren Vorteil der digitalen Kommunikation darstellt. Dies gilt es daher weiter zu prüfen.
Die OGS muss nun überlegen, in welcher Weise sie die sprachlichen und medialen Vorkenntnisse und auch Bedarfe der Eltern stärker berücksichtigen und Kommunikation mit der Elternschaft verbessern kann. Dass die digitale Kommunikation hier Potenziale bietet, hat die Befragung gezeigt. Als nächster Schritt ist die Entwicklung datenschutzkonformer Handlungsempfehlungen für die Elternkommunikation geplant.